
Fortnite, Roblox oder Clash of Clans: Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland verbringen täglich Zeit mit sogenannten Free-to-Play-Games. Was harmlos und kostenlos wirkt, kann Familien jedoch teuer zu stehen kommen. Denn mit nur wenigen Klicks landen Skins, Lootboxen oder Spielwährungen im Warenkorb – oft ohne Wissen der Eltern.
Zum Start der „Gamescom“ warnt das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) vor hohen Rechnungen und gibt Tipps, wie sich Familien schützen können.
Gratis-Games – beliebt, aber nicht wirklich kostenlos
Laut der JIM-Studie 2024 spielen 73 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland regelmäßig Videospiele – vor allem auf dem Smartphone oder Tablet. Besonders angesagt sind „Free-to-Play“-Titel wie Fortnite, Roblox, Minecraft oder Brawl Stars. Diese Spiele sind zwar kostenlos herunterzuladen, verdienen ihr Geld jedoch über In-App-Käufe.
„Die Spiele verleiten dazu, Geld auszugeben. Sei es, um Wartezeiten zu überbrücken, für eine besondere Ausrüstung oder In-Game-Währungen wie Coins oder Juwelen“, erklärt Alexander Wahl vom EVZ. Das Geschäft mit In-Game-Käufen ist Milliarden wert – und trifft besonders Kinder und Jugendliche.
Wenn Kinder hunderte Euro ausgeben – wer zahlt?
Ein Beispiel: Der zehnjährige Lukas spielte regelmäßig Clash of Clans und Brawl Stars auf dem Tablet seiner Mutter. Ohne Erlaubnis kaufte er virtuelle Inhalte für insgesamt 1.200 Euro, abgerechnet über die Kreditkarte im Google Play Store.
Müssen Eltern diese Rechnung bezahlen? Grundsätzlich nicht, erklärt Jurist Wahl:
- Kinder unter 7 Jahren sind nicht geschäftsfähig und können keine wirksamen Käufe tätigen.
- Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren dürfen nur mit Zustimmung der Eltern Verträge schließen – außer beim sogenannten Taschengeldparagrafen. Der gilt allerdings nur für kleinere Summen, die aus dem eigenen Taschengeld bezahlt werden.
Eltern sollten daher sofort Widerspruch einlegen, wenn Kinder ungewollt Käufe getätigt haben, rät der Experte. Schwierig wird es allerdings, wenn Kinder wiederholt auf Kosten der Eltern bezahlt haben oder wenn sie deren Passwort und Zahlungsdaten nutzten – dann kann es sein, dass Gerichte von einer stillschweigenden Zustimmung ausgehen.
Verbraucherschützer kritisieren das Geschäftsmodell
Schon lange stehen In-App-Käufe in der Kritik. Die europäische Verbraucherschutzorganisation BEUC warnte 2024 vor versteckten Kosten und unfairen Methoden. Erst im März 2025 veröffentlichte die EU-Kommission neue Leitlinien für In-Game-Währungen: Spiele sollen künftig transparenter darstellen, wie viel virtuelle Inhalte in Euro kosten. Noch handelt es sich dabei aber nur um Empfehlungen, keinen verbindlichen Rechtsrahmen.
So schützen sich Eltern – die wichtigsten Tipps
Damit es gar nicht erst zu teuren Überraschungen kommt, rät das EVZ:
- Passwortschutz aktivieren: Käufe in App-Stores nur nach Eingabe eines Passworts erlauben.
- In-App-Käufe deaktivieren: In den Einstellungen von Google Play oder Apple App Store lassen sich Käufe komplett sperren.
- Keine Kreditkarte hinterlegen: Besser mit Prepaid-Karten bezahlen – so bleiben Ausgaben im Rahmen.
- Drittanbietersperre aktivieren: So werden Käufe über die Handyrechnung verhindert.
- Kinder aufklären: Frühzeitig erklären, dass virtuelle Käufe echtes Geld kosten.
„Vorsicht ist besser als Nachsicht“, fasst EVZ-Experte Wahl zusammen. Eltern sollten schon vor dem ersten Download die Sicherheitseinstellungen prüfen.

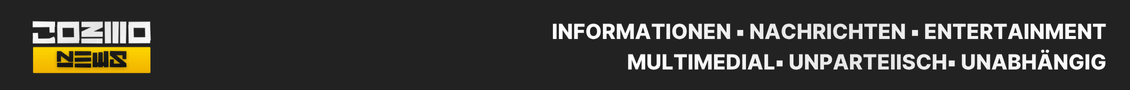


Kommentare