
Die Deutschen gelten als Weltmeister im Meckern. Jetzt beweist auch die Wissenschaft: 17 Prozent von uns denken populistisch. Heißt übersetzt: Jeder Sechste sitzt mit gefalteten Armen da, schaut in Richtung Berlin und sagt: „Die da oben sind schuld.“ An allem. Immer. Was Populismus so attraktiv macht? Er funktioniert wie Instantnudeln – heißes Wasser drauf, umrühren, fertig ist die Meinung. Komplexe Probleme verschwinden, es bleibt nur ein klarer Schuldiger: „die Elite“, „die Medien“, „Brüssel“, „die Ampel“, manchmal sogar „das Wetter“. Hauptsache einfach.
Und wie reagiert die Politik? Manche glauben, man müsse Populisten nur imitieren – mit einem Hauch Anstand und besserer Grammatik. Das Ergebnis ist bekannt: Wer versucht, dem Protest noch populistischer entgegenzuschreien, verliert am Ende seine Stimme. Und seine Prozentpunkte gleich mit.
Populismus ist wie ein politischer Energy-Drink: laut, süß, macht wach – und hinterlässt Herzrasen und Kopfschmerzen. Manche gewöhnen sich so sehr daran, dass sie ohne Empörung kaum noch in den Tag starten. Kein Wunder – Empörung ist bequem. Wer wütend ist, muss sich nicht erklären.
Dabei gäbe es Gegenmittel, ganz unspektakulär: Bildung, Gespräch, Verantwortung, Realitätssinn. Nur klingen sie halt weniger sexy als „Systemversagen“ oder „alles Lüge“. Sie erfordern Zeit, Nachdenken – und manchmal die Erkenntnis, dass man selbst Teil des Problems sein könnte. Unangenehm.
Sind 17 Prozent also viel? Die gute Nachricht: 83 Prozent glauben immer noch nicht, der Paketbote sei ein Agent der Weltverschwörung. Die schlechte: Die Kommentarbereiche im Internet lassen das manchmal anders wirken. In diesem Sinne: Populismus schreit. Demokratie spricht leise – und denkt vorher nach.

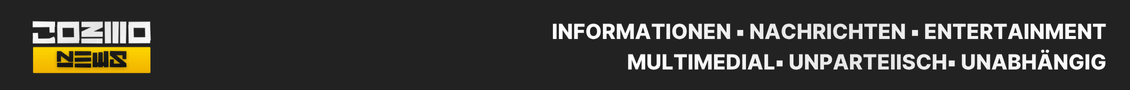


Kommentare