
Die Bundesregierung will das Rentenniveau bis 2030 stabil halten – ein beruhigendes Signal für heutige Rentner. Doch was bedeutet das für die junge Generation? Zwischen steigenden Abgaben und sinkendem Vertrauen wächst der Druck auf das solidarische System.
Leon ist 28, arbeitet als IT-Fachkraft in Berlin – und zahlt jeden Monat rund 400 Euro in die Rentenkasse. „Ich mache das, weil ich muss. Aber ob ich jemals etwas zurückbekomme, weiß niemand.“ Mit dieser Skepsis ist er nicht allein.
Die Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48 Prozent klingt für viele wie eine gute Nachricht – für heutige Rentner ist sie das auch. Doch bei den Beitragszahlern von morgen wächst das Gefühl, Teil eines Spiels zu sein, dessen Regeln sie nicht kennen – aber zahlen sollen.
Experte warnt: System wird nicht stabilisiert – nur gestützt
Florian Schuster-Johnson, Ökonom beim Thinktank „Dezernat Zukunft“, sieht in dem neuen Rentenpaket der Bundesregierung ein riskantes Manöver: „Das Paket verhindert, dass heutige Rentner weniger Geld haben oder gar in Armut fallen. Aber es stabilisiert nicht das Rentensystem – es belastet den Bundeshaushalt zusätzlich.“
Tatsächlich wird die Rente schon heute zu einem beträchtlichen Teil aus Steuermitteln finanziert: Über ein Viertel des Bundeshaushalts fließt in Rentenzuschüsse. Künftig könnten diese Mittel noch steigen – während andere Zukunftsbereiche wie Bildung, Digitalisierung oder Klimainvestitionen zurückstehen.
Vertrauen in die gesetzliche Rente sinkt
Laut einer Umfrage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge glauben nur noch 29 Prozent der unter 35-Jährigen, dass sie im Alter allein mit der gesetzlichen Rente auskommen werden. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit über Alternativen – denn wer jung ist, hat selten das Kapital, um privat vorzusorgen.
Was jetzt passieren müsste
Für Schuster-Johnson ist klar: Eine Reform muss auf der Einnahmeseite ansetzen – also bei den Beschäftigtenzahlen, Löhnen und Arbeitsbedingungen. „Wenn die Regierung die Rente stabilisieren will, muss sie dafür sorgen, dass mehr Menschen arbeiten, genug verdienen und am Ende Beiträge zahlen.“
Das bedeutet konkret:
- bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- attraktive Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitnehmer
- gezielte Fachkräfteeinwanderung
- höhere Erwerbsquoten bei Frauen
Nur mit diesen Maßnahmen könne langfristig das Vertrauen wieder wachsen – und damit die Akzeptanz für ein System, das auf Solidarität beruht.
Fazit: Verantwortung für Generationengerechtigkeit
Die Frage, ob man auf 48 Prozent Rentenniveau stolz sein kann, lässt sich nicht pauschal beantworten. Für viele Ältere ist sie eine Erleichterung. Doch für viele Jüngere bleibt sie ein weiteres Beispiel dafür, wie politische Entscheidungen oft zu Lasten der Zukunft getroffen werden.
Wer jetzt über Generationengerechtigkeit spricht, muss mehr bieten als Garantien bis 2030. Er muss zeigen, wie das System auch 2050 noch funktioniert.

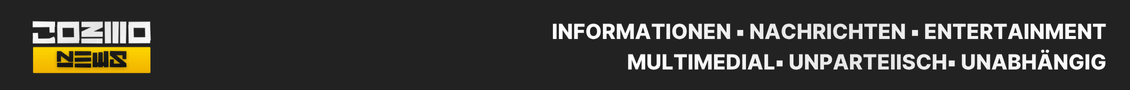
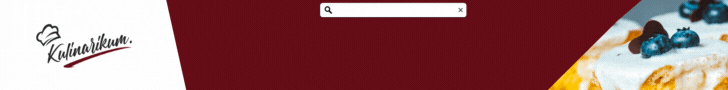

Kommentare