
Fränkisches Rauchbier ist eine Bierspezialität, die durch die Vergärung von Rauchmalz entsteht und ihren Ursprung in der jahrhundertealten Brautradition Bambergs hat. Historisch bedingt war das Räuchern des Malzes überall dort nötig, wo man keine Sonnentrocknung durchführen konnte – so auch in Franken.
Heute bewahren vor allem die Brauereien „Schlenkerla“ und „Spezial“ dieses aufwendige Verfahren und haben das Rauchbier zu einer regionalen Kultmarke gemacht.
In diesem Artikel nehmen wir dich mit auf eine Reise in die faszinierende Geschichte des Rauchbieres und führen dich Schritt für Schritt durch die Kunst des Rauchmalzes, den Brauprozess sowie die Reifung und Abfüllung. Zum Abschluss zeigen wir dir, wie sich das charakteristische Aroma deines Rauchbiers entfaltet und geben dir Tipps für das perfekte Geschmackserlebnis.
Geschichte des Rauchbiers in Franken
Die Tradition des Rauchbieres in Franken reicht bis ins Mittelalter zurück, als Gräser und Brauer ihre Malzschwemme noch über offenem Feuer darren mussten, um sie haltbar zu machen. Im Zuge der Industrialisierung ging das handwerkliche Räuchern vielerorts verloren, doch in Bamberg haben die Brauereien „Spezial“ (gegründet 1536) und „Schlenkerla“ (erwähnt seit 1405) das Verfahren bis heute kontinuierlich fortgeführt. 2017 wurden beide traditionellen Rauchbiere in die „Arche des Geschmacks“ von Slow Food aufgenommen, um die historische Herstellungsweise zu erhalten.
Rohstoffe und Herstellung des Rauchmalzes
Das zentrale Unterscheidungsmerkmal ist das Rauchmalz, das auf einer Darre getrocknet wird, während Rauch von Buchen- oder Eichenholz durchströmt. Dabei wird das Grünmalz auf einem Metallsieb oder auf Bambusrosten gelagert und gleichmäßig erhitzt, während das aufsteigende Rauchgas aromatische Phenole einlagert. Bei „Schlenkerla“ setzt man vorwiegend Buchenholz ein, während „Spezial“ teilweise auf Kirsch- und Erlenholzvarianten zurückgreift, um unterschiedliche Rauchnuancen zu erzielen. Die renommierte Weyermann-Mälzerei in Bamberg sorgt für eine gleichbleibende Qualität, indem sie die Regionalität der Gerste und kontrollierten biologischen Anbau sicherstellt.
Brauprozess im Überblick
- Schroten und Maischen
Das Rauchmalz wird im ersten Schritt geschrotet und in warmem Wasser eingeweicht, um die im Malz enthaltenen Enzyme zu aktivieren und Stärke in vergärbare Zucker umzuwandeln. - Läutern
Nach dem Maischen trennt man die flüssige Würze von den festen Spelzen, sodass eine klare, rauchige Würze zurückbleibt. - Kochen mit Hopfen
Die Würze wird unter Zugabe von Aromahopfen aufgekocht. Die Hitze löst Bitterstoffe, während Wasser verdampft und die Stammwürze steigt. - Kühlen und Anstellen
Anschließend kühlt man die Würze rasch, belüftet sie und impft sie mit untergäriger Hefe. Die Hauptgärung dauert rund sieben Tage bei niedrigen Temperaturen. - Lagerung (Reifung)
Das Jungbier lagert mehrere Wochen in kühlen Kellergewölben, wo sich das Aroma harmonisiert und die letzten Trubstoffe absinken.
Abfüllung und Filtration
Nach der Lagerung wird das Rauchbier filtriert, um Hefen und Schwebstoffe zu entfernen. Für das klassische „Eichenfass“-Erlebnis setzt „Schlenkerla“ auf dabei traditionelle Holzfässer, die unter Gegendruck befüllt werden. Ein ähnliches Verfahren kommt bei der Flaschenabfüllung zum Einsatz, um Schaumverlust zu minimieren.
Geschmacksprofil und Serviervorschläge
Fränkisches Rauchbier besticht durch eine ausgewogene Balance von malziger Süße und rauchiger Würze, begleitet von leicht erdigen Hopfenaromen. Beim „klassischen Seidla“ – einem halben Liter – empfiehlt sich eine Trinktemperatur von etwa 8 °C, um das volle Aroma zu entfalten.
Traditionell passt Rauchbier gut zu kräftigen Gerichten wie Schäufele (Schweineschulter), Zwiebelkuchen oder deftigem Bergkäse. Auch zu gegrilltem Fleisch und herzhaften Eintöpfen ist es ein idealer Begleiter.
Fränkisches Rauchbier ist somit nicht nur ein Relikt vergangener Braukultur, sondern eine lebendige Tradition, die mit moderner Technik verbunden doch unverfälscht bleibt. So wird die rauchige Geschmackswelt Bambergs und Umgebung bis heute zelebriert und weltweit geschätzt.
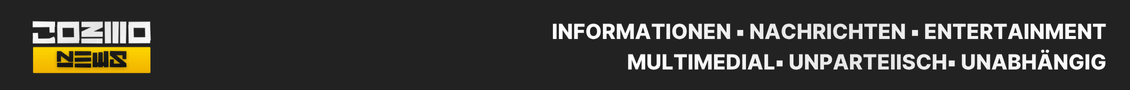
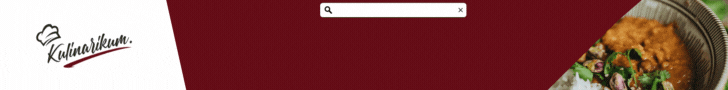

Kommentare